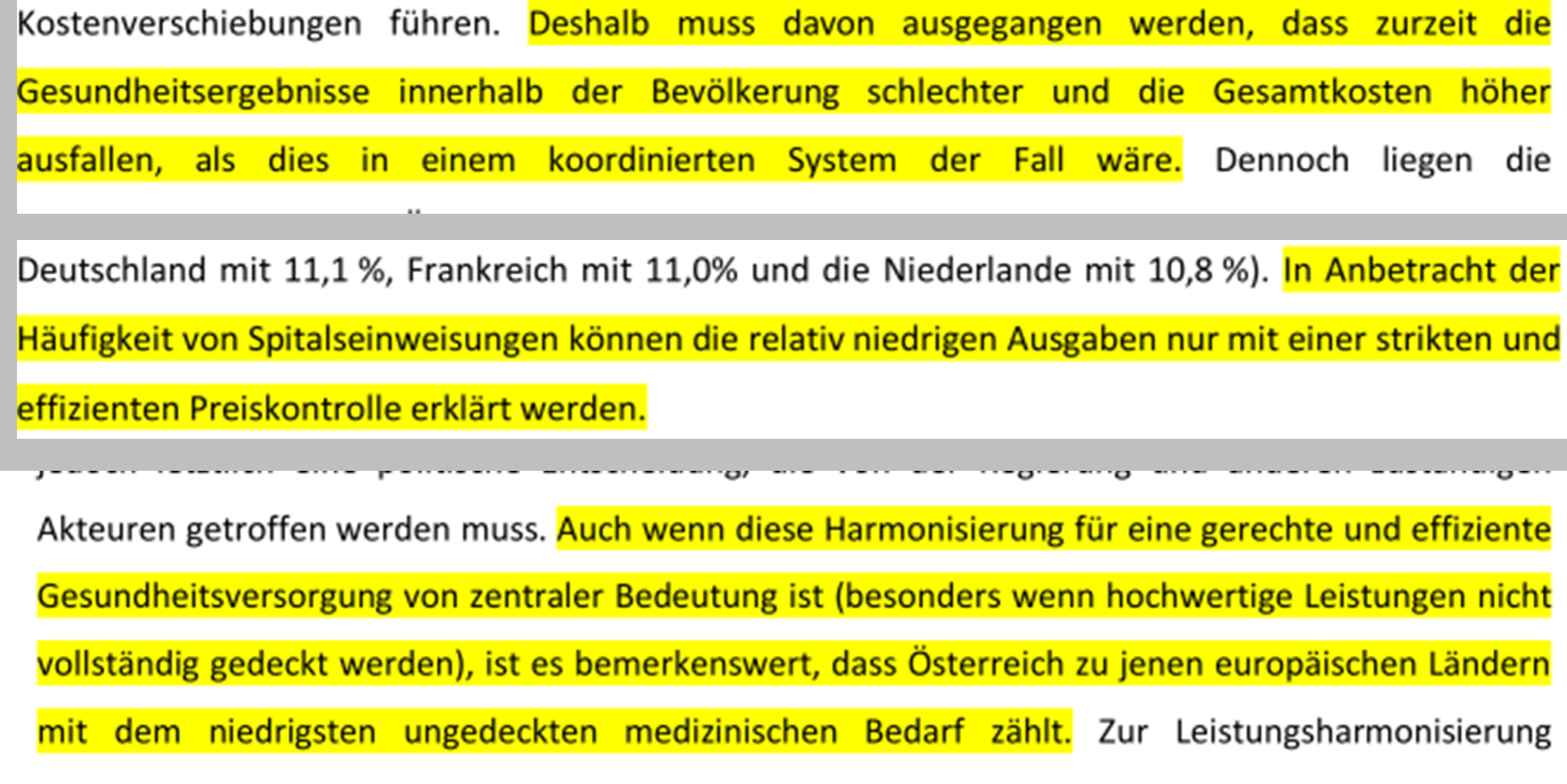630.000 Euro für 1400 Seiten, davon 930 in gesundheitsökonomischem Fachenglisch, die unübersetzt blieben.
Weiterlesen: Eine Studie, die keine oder alle Schlüsse zulässtLeichte Kost ist die Studie nicht. Die Rede ist von einer Studie der London School of Economics (LSE) im Auftrag des Sozialministeriums, die eine Handlungsanleitung zur Reform der Sozialversicherung geben sollte.
Nach der Lektüre einiger hundert Seiten stellt sich das Werk als Zusammenfassung bekannter Lehrmeinungen und Theorien ohne eigene Berechnungen dar – also ein Lehrbuch. Eine Studie, die helfen soll Entscheidungen zu treffen, ist es nicht – nicht nur wegen des Umfangs. Selbst dort, wo es Vorschläge gibt, bleibt es eine Aufzählung von dem, was die Lehre der Gesundheitssystemforschung anzubieten hat. Eine Bewertung der Vorschläge fehlt, womit beliebig gewählt werden kann. Und so verwundert es nicht, dass sich alle auf das sogenannte „Modell 4“ stürzen, das alles so beibehält, wie es ist, und nur durch mehr Risikostrukturausgleich und bessere Koordination durch gemeinsame Servicezentren ergänzt.
Nun, in der Studie (Kapitel 4, Seite 131 ff) klingt das anders.
Da wird klar, wie mächtig diese gemeinsamen „Servicezentren“ sein müssten; sie übernähmen alle wesentlichen Aufgaben aller Krankenkassen, wie etwa die Verhandlungen mit den Ärztekammern. Es wäre daher eine Art virtuelle Kassenfusion. Zudem müssten alle Kassen all ihr Geld (nicht nur zwei Prozent) in einen Topf werfen, von dem dann, je nach Krankheitsrisiko der Versicherten, mehr oder weniger zurückfließt. Und weil es keine weitreichenden Gesetzesänderungen geben darf (so die Prämisse des Modells 4), muss alles freiwillig sein.
Da aber, wie zu lesen, erhebliche Rechtsrisiken blieben, etwa, dass die Beamtenversicherung aus verfassungsrechtlichen Gründen bei so einem Risikostrukturausgleich nicht mitmachen könnte, schlägt man Minischritte vor, an deren Ende die derzeitige Verfassung umgangen werden kann. Damit das funktioniert, soll der Staat mit Steuergeld in den Risikoausgleich einsteigen, freilich ohne mehr Mitspracherecht in der Selbstverwaltung zu erhalten.
Nach Schätzungen würde das etwa 1,2 Milliarden Euro ausmachen, die in höhere Arzthonorare (eine Steigerung um ein Drittel zu heute) fließen müssten. Das ist schwieriger umzusetzen als eine Verfassungsänderung, die in den Modellen 1 bis 3 notwendig wäre. Aber das macht nichts, kaum jemand kann so gut Englisch, dass er gesundheitsökonomische Fachliteratur lesen kann. Und weil dieses Werk so dick und unübersichtlich ist, werden selbst die, die es könnten, nicht monatelang darüber brüten. Die, die es tun, werden es tun, um herauszulesen, was für die eigene Institution passt. Und weil niemand nachlesen kann/will/wird, kommen die damit locker durch.
Und so hören wir, dass „die LSE-Studie der bestehenden Struktur der Sozialversicherungen ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt hat“, auch wenn dort steht, dass „davon ausgegangen werden muss, dass zurzeit die Gesundheitsergebnisse innerhalb der Bevölkerung schlechter und die Gesamtkosten höher ausfallen, als dies in einem koordinierten System der Fall wäre“.
P.S.: Erschreckend ist die Fehlerquote. Bei einer monatelangen Verzögerung und einem Preis von etwa 500 Euro pro Seite könnte man ein Lektorat erwarten – oder wurde noch ganz schnell umgeschrieben?
„Wiener Zeitung“ Nr. 169 vom 31.08.2017