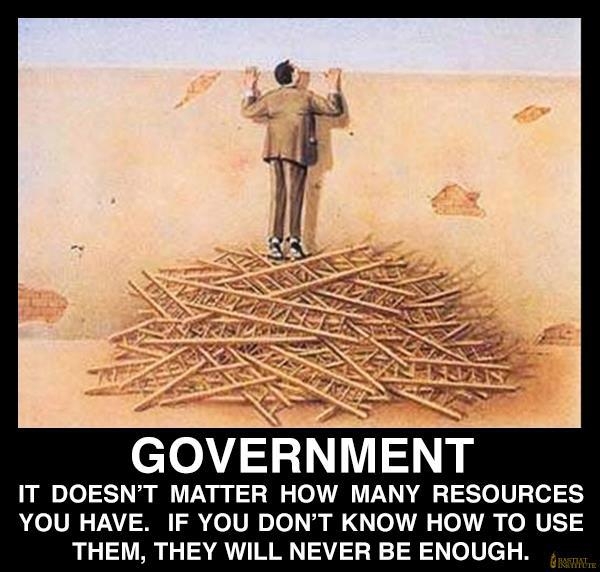(8 Min Lesezeit) Errichtet man 1.041 neue Kassenstellen, dann erspart man sich in der Versorgung 322.000.000 €. Das rechnet die Ärztekammer in einem Simulationsmodell vor.
Und wie schaut dieses Modell aus?
Das erste, das auffällt ist, dass es sich um ein rein betriebswirtschaftliches Rechenmodell handelt, weit weg von gesundheitsökonomischen Ansätzen. Es finden sich keine Versorgungskonzepte für bestimmte Patientengruppen oder Angaben zum Patientennutzen – gar nichts. Mehr noch, das Wort Patienten kommt KEIN einziges Mal als Bezeichnung für einen kranken Menschen vor, sondern wird ausschließlich als Maßeinheit verwendet.
Diesem rein betriebswirtschaftlichen Ansatz entsprechend, wird daher auch nur in Kosten pro Leistungserbringer (Kassenarzt oder Spitalsambulanz) gerechnet, und nicht, wie eben in der Gesundheitsökonomie üblich, in Kosten pro Patientennutzen. Das ist schon verstörend, weil gerade die Ärztekammer die „Ökonomisierung“ des Gesundheitssystems beklagt, und selbst doch nur betriebswirtschaftlich zu denken scheint.
Aber vielleicht ist es wenigstens eine gute betriebswirtschaftliche Rechnung?
Weil das Simulationsmodell ja dazu dienen soll, einen Vergleich der Spitalsambulanzen und des niedergelassenen Bereiches anzustellen (Da Modell heißt ja schon: Kosteneinsparungspotential – Ambulanzauslagerung), wurden für Spitalsambulanzen die Kenngrößen „Frequenzen ambulanter Patienten“ und „Ambulanten Endkosten (lt. Kostenrechnungsvorschriften)“ herangezogen, für den niedergelassenen Bereich die „Frequenzdaten lt. eCard-Steck-Statistik“ und „Kassenhonorare lt Ärztekostenstatistik des Hauptverbandes“. Offenbar ging der Auswahl dieser Maßeinheiten ein Diskussionsprozess in einer extra eingerichteten Arbeitsgruppe der Österreichischen und der Länder – Ärztekammern voraus.
Gerechnet wird also mit Kosten der Spitalsambulanzen und der Honorarsumme niedergelassener Kassenärzte, die entweder durch Ambulanzfrequenzen bzw. eCard- Konsultationen als Kostenträger dividiert werden – die Quotienten dieser Divisonen werden dann gegenüber gestellt, gerade so, als ob beide, also Spitalsambulanzen und Kassenärzte das gleiche tun und gegeneinander austauschbar sind, aber:
1.) sind die Kosten vergleichbar?
2.) sind die Kostenträger vergleichbar?
3.) sind die beiden Leistungserbringer linear substituierbar?
Kostenseite:
Bei den Spitalskosten werden „ambulante Endkosten“ herangezogen. Diese werden als solche in der offiziellen Kostenstatistik ausgewiesen, und sollten jene sein, die nur für ambulante Patienten entstehen.
Also (Voll)Kosten für Konsile an stationäre Patienten sollten nicht mitgerechnet sein, weil sie den jeweiligen Stationen im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung weitergegeben sein sollten. Wer sich mit innerbetrieblicher Weiterverrechnung von Kosten im Allgemeinen und in Österreichischen Spitälern im Besonderen auskennt, weiß, dass diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind. Umso mehr, als eine Kostenträgerrechnung in so gut wie keinem Spital etabliert ist. Man muss also davon ausgehen, dass hier extreme Unschärfen zu finden sind.
Aber sei es drum, nehmen wir an, die Kosten stimmen grosso modo und die ausgewiesenen „ambulanten Endkosten“ sind wirklich jene , die ausschließlich für ambulant versorgte Patienten anfallen. Enthalten sind dabei Kosten für Raum, Heizung, Medikamente und Verbände etc., genau so wie Personalkosten für etwa 2.700 Ärzte, 2.900 Krankenpflegepersonen, 2.900 Personen des Medizinisch-Technischen Dienstes, 1,000 Personen der sozialen Hilfsdienste, 1.100 Personen für Verwaltung, Betrieb etc., aber auch z.B.: 170 Apotheker und 110 Hebammen! In Summe sind es etwa 11.000 Vollzeitkräfte, die nötig sind, in den Spitalsambulanzen 7 Tage pro Woche, 24 Stunden pro Tag, die durch ambulante Patienten anfallende Arbeit zu erledigen.
Dem gegenüber wird bei Kassenärzten die Honorarsumme als Kosten angegeben. Davon werden pro Ordination im Schnitt 2 Mitarbeiter bezahlt – eine davon ist wohl eine Sprechstundenhilfe, bekanntermaßen eine der schlechtest verdienenden Berufe. Und bei den verbleibenden, wie viele davon sind Apotheker, diplomiertes Pflegepersonal oder Physiotherapeuten? Nun, Leistungen dieser Berufsgruppen liegen überwiegend außerhalb des normalen Kassen-Ordinationsbetriebes und müssen daher nicht über Honorare finanziert werden. Und wie sieht es mit Medikamenten, Verbänden etc. aus? Diese werden von Seiten der Krankenkassen überwiegend (Medikamente und Heilbehelfe) in anderen Kostengruppen geführt, und belasten somit auch nicht die Honorare, was dazu führt, dass die Kosten wohl unterschätzt werden.
Kurz gesagt, auf Kostenseiten werden Äpfel mit Birnen verglichen.
Kostenträgerseite:
Als Kostenträger werden in der Spitalsambulanz die Frequenzen herangezogen. Die dahinterliegende Definition ist in den Verordnungen zur Krankenanstaltenstatistik festgelegt und etwas kompliziert. Vereinfacht ausgedrückt, entsteht eine Spitalsfrequenz an ambulanten Patienten immer dann, wenn ein Patient von einem Arzt behandelt wird. Jede Spitalsfrequenz führt also zu einem Arzt-Patienten-Kontakt. Nicht mitgezählt werden patientenferne Service-Leistung – also solche wo KEIN Arzt-Patienten-Kontakt entsteht. Das betrifft viele der radiologischen Leistungen, aber vor allem das Labor. Labor-Leistungen sind quasi rein patientenferne Service-Leistung, die nie zu einer Frequenz führen; und das ist für Vergleiche, wie sie das Ärztekammer-Ambulanzmodell anstellen will, keine unbedeutende Größe, da die Kosten der Laborleistungen sehr wohl auf die Ambulanzen umgelegt werden und so die Frequenz „verteuern“, weil eben der Divisor kleiner ausfällt.
Der Kostenträger im Kassenbereich ist die eCard-Konsultation. Eine solche tritt jedes Mal auf, wenn ein Patient eine Ordination betritt und seine eCard „gesteckt wird“. Also eigentlich immer, egal bei welchem Arzt, egal aus welchem Grund – auch, wenn der Arzt den Patienten gar nicht sieht, also z.B. im Rahmen einer Rezept-Ordination. Wieviele der etwa 100 Mio. eCard-Konsultationen „patientenfern“ stattfinden wird nicht dokumentiert, es wird aber eine sehr sehr große Zahl sein (vielleicht 20 Mio. oder sogar mehr, da es pro Versicherungsfall im Schnitt etwa zu 3 eCard-Konsultationen kommt?). Wenigstens beim Hausarzt ist das auch zu hoffen, weil wir einfach zu wenige haben und die Weiterverschreibung von Medikamenten wirklich nicht jedes Mal eine ärztliche Konsultation verlangt (übrigens sind die häufigen Verschreibungen bei uns deswegen nötig, weil die Kassen die Packungsgrößen klein halten, um öfter Rezeptgebühr einheben zu können – aber das ist ein anderes Thema). Was nun den Ressourcenverbrauch betrifft, der ja in Kosten ausgedrückt wird, ist es jedoch nicht anzunehmen, dass solche patientenfernen eCard-Konsultationen auch nur annähernd den gleichen Ressourcenverbrauch haben wie jene die mit einem Arzt-Patienten-Kontakt einher gehen. Aber dadurch, dass alle eCard-Konsultationen gezählt werden, wird der Divisor groß und die Frequenz „verbilligt“.
Wie auch immer, der direkte Vergleich Frequenz und eCard-Konsultation ist ebenfalls ein Vergleich von Äpfel und Birnen.
Und da ja im Vergleich die Kosten der Spitalsambulanzen durch Frequenzen und die Honorarsummen niedergelassener Kassenärzte durch eCard- Konsultationen dividiert werden, ist das was rauskommt jedenfalls nur Obstsalat. Und ohne genaueres Aussagen zu wollen, deutet alles darauf hin, dass mit dieser simplen Methode, die definitiv keine (wenigstens nicht etablierte) Modellrechnung ist, die Kosten pro Kostenträger im Kassenbereich deutlich unter-, die in den Spitalsambulanzen deutlich überschätzt werden. Und das dürfte wohl auch der Sinn der Übung sein.
Das Simulationsmodell
Nun dieser Schluss, dass es sich hier NICHT um eine echte Rechnung, sondern einfach eine pseudoobjektive politische Argumentation handelt, ist auch noch aus anderen Annahmen des Simulationsmodells zu erahnen.
Entsprechend der einfachen Division der angenommenen Kosten durch die angenommenen Kostenträger komm eben im Kassenbereich als auch in der Spitalsambulanz mehr oder weniger betriebswirtschaftlich ermittelte, direkte Fallkosten heraus, die gegenüber gestellt werden. Demnach „kostet“ die Versorgung eines Falles (von Patient kann man nicht sprechen, weil eben keine patientenorientierte Vorgangsweise gewählt wurde) in der Spitalsambulanz 92,42€, beim Facharzt 44,20€ und beim Hausarzt 14,23€ (was für ein Tarif!). Und darauf wird nun das Simulationsmodell aufgebaut, das in einer Presseaussendung folgendermaßen beschrieben wird:
Der Bundesobmann der niedergelassenen Ärzte (Anm.: Dr. Steinhart) stellte dazu ein Simulationsmodell der Österreichischen Ärztekammer vor, wonach 75 Prozent der Ambulanzbesuche durch den niedergelassenen Bereich aufgefangen werden könnten. Das hätte einen volkswirtschaftlichen Netto-Einsparungseffekt von 322 Millionen Euro zur Folge. Dazu seien allerdings zusätzlich 1041 Vertragsarztstellen im niedergelassenen Bereich notwendig. Die Rechnung der ÖÄK basiert auf durchschnittlichen Kosten des Patientenkontaktes in Ambulanzen in der Höhe von 92 Euro, wohingegen ein durchschnittlicher Facharztbesuch mit nur 44 Euro zu Buche schlägt. Berücksichtigt im Ärztekammermodell sind auch Restkosten ausgelagerter Ambulanzleistungen, verbliebene Ambulanzleistungen sowie die Kosten der Leistungsübernahme durch neue niedergelassene Versorgungseinheiten, sodass sich der ursprüngliche Brutto-effekt von rund 1,2 Milliarden Euro in einem volkswirtschaftlichen Auslagerungsnutzen von jährlich netto 322 Millionen niederschlägt.
Hier wird also gleich zwei Mal das Wort „volkswirtschaflich“ verwendet, doch ist das korrekt? Natürlich nicht, weil das eingesetzt Geld volkswirtschaftlich nicht verschwindet. Wenn überhaupt volkswirtschaftlich hier was gespart wird, dann höchstens jener Anteil, der möglicherweise über den aktuellen Allokationsmechanismen mehr ins Ausland abfließt als mit einem dann anderen Allokationsmechanismus – also das Geld und damit die Wertschöpfung verstärkt im Inland bleibt. Aber was soll’s – ich bin ja auch kein Volkswirt, daher sollte ich solche Sachen auch nicht erklären. Was allerdings ein volkswirtschaftlicher Auslagerungsnutzen ist, werden diese auch nicht erklären können, er ist eine Wortkreation der Ärztekammer. Vermutlich geht es bei dem Begriff „volkswirtschaftlich“ darum, abzulenken, dass es sich hier um ein schnödes betriebswirtschaftliches Kalkulationsmodell handelt – um sonst nichts.
Viel wichtiger als diese offensichtlich völlig falsch verwendeten Begriffe, sind die Angaben, wie nun das Einsparungspotential des „volkswirtschaftlichen Auslagerungsnutzes“ errechnet wird.
Angenommen wird, dass etwa 13 Mio. der 17 Mio. Ambulanzfrequenzen in neu zu errichtende Kassenordinationen ausgelagert werden können. Da ich die spärlichen Hintergrundspapiere auch habe, weiß ich, dass dieser Zahl keine Versorgungskonzepte zu Grunde liegen. Es wird also nicht spezifiziert, welche Patienten denn nun NICHT mehr in der Spitalsambulanz behandelt werden sollen. Ebenfalls nicht ausgesagt wird, ob diese Verlagerung eventuell an Ausstattungsmerkmalen festgemacht wird, also vielleicht nur jene Leistungen im Spital bleiben, die aufgrund der dortigen apparativen Ausstattung (vom Labor bis zur Bildgebung) oder dem Vorhandensein mehrerer Disziplinen zentralisiert bleiben müssen. Nein, es ist schlicht ein Prozentsatz, der angegeben wird – ohne irgendwelche Angaben zu machen.
Denkt man darüber nach, stellt sich natürlich die Frage, welche 4 Mio. Frequenzen das sein sollen, die da im Spital bleiben müssen, weil Kassenärzte sie nicht betreuen können? Wie charakterisieren sich die verbleibenden Frequenzen?
Solche Fragen sind nicht unerheblich, da ja vermutlich für diese 4 Mio. die volle Infrastruktur aufrecht erhalten bleiben muss – und zwar 7 Tage die Woche und 24 Stunden pro Tag. So was kostet! Und da ja die Ärztekammer in ihrem „Modell“ davon ausgeht, dass 75% der Fall-Kosten abgebaut werden können (Mittelfristig – wann immer dass sein mag!), also nur 25% Remanenzkosten bleiben, stellt sich die Frage, wie diese Infrastruktur nach Meinung der Kammer aussehen soll. Aber mehr noch, es geht ja bei der Entlastung der Spitäler nicht nur um Infrastruktur, sonder auch darum, das überlastete Spitalspersonal zu entlasten. Also schlägt die Kammer wohl kaum einen radikalen Personalabbau vor. Da aber nur etwa 40% der Ambulanzkosten auf Sachkosten zurückzuführen ist, kann es doch nicht sein, dass man OHNE Personalabbau 75% der Kosten pro Fall einsparen kann – oder doch? Müsste dann die gesamte Infrastruktur abgebaut werden? Und wenn sich das ausginge, was es nicht tut, wo würden dann die 4 Mio. nicht auslagerungsfähigen Frequenzen versorgt? Auf den Bettenstationen?
Und wie schaut es mit den 13 Mio. ausgelagerten Frequenzen, die nun zu eCard-Konsultationen werden sollen, aus? Auch hier natürlich keine Aussage, um welche Patienten es sich handelt und welchen Bedarf sie darstellen, welche Leistungen sie brauchen, oder WANN diese Leistungen gebraucht würden.
Aber gerade letzteres wäre für ein derartiges Rechenmodell wichtig. Üblicherweise sind Kassenfachärzte nur verpflichtet die Ordination etwa 20 Stunden pro Woche zu öffnen. Werden Patienten außerhalb der Ordinationszeiten versorgt, werden Zuschläge verrechnet. Wird eine Versorgung in der Nacht nötig, oder am Wochenende, fällt der Zuschlag höher aus. Die Höhe dieser Zuschläge liegt schnell bei 50% des „normalen Tarifs“. Da aber in der aktuellen Rechnung, die von 44 Euro pro eCard-Konsultation ausgeht kaum solche Patienten zu finden sind, die außerhalb der Ordinationszeiten behandelt wurden, ist es fraglich, ob der angesetzte Wert wirklich zu halten ist.
Dass die Kassenärzte außerhalb der Ordinationszeiten nicht arbeiten ist übrigens völlig in Ordnung. Die Tarife sind so niedrig, dass sie als solches schon nicht gerade ein Anreiz sind, eine Ordination für „Laufkundschaft“ offen zu halten. Richtig auszahlen tut sich eine Ordination, dank des Einzelleistungshonorierungssystems nur, wenn das Wartezimmer gerammelt voll ist, keine Leerzeiten für den Arzt auftreten und möglichst keine akuten Fälle warten. Dazu ziehen diverse Deckelungen automatisch Leistungsobergrenzen ein. Es wäre also durchaus möglich, dass Ärzte bei längeren Öffnungszeiten schwierigere, weil akutere Patienten auch noch gratis behandeln müssten. Anders ausgedrückt, es grenzt an Masochismus oder wenigstens Selbstausbeutung, wenn Kassenärzte bei den heutigen Tarifen außerhalb der vorgeschriebenen Ordinationszeiten versorgungswirksam werden. Und es hat ja einen Grund, warum gerade in Tagesrandzeiten und am Wochenende die Spitalsambulanzen voll sind.
Jedenfalls ist anzunehmen, dass ein Teil der zu verlagernden Frequenzen außerhalb der heute üblichen Ordinationszeiten versorgt werden müssten, was automatisch zu einer Erhöhung der Kosten pro eCard-Konsultation führen muss. Aber welchen Preis sollte man also ansetzen, wenn 44€ jedenfalls zu wenig sein werden? 55€, 66€ 88€?
Am Ende ist alles eine sehr wirre „Simualtionsrechnung“, die mit völlig unplausiblen Annahmen „modelliert“ wird. Doch das skurrilste und verworrenste an dieser Rechnung ist, dass die eCard-Konsultationen für diese geforderten, neuen 1.041 Fachärzte mit ca. 13.000 pro Jahr angenommen werden. Aktuell haben Fachärzte jährlich aber nur 8.600 eCard-Konsultationen. Warum also sollen die neugeschaffenen Stellen um 4.400 eCard-Konsultationen mehr abarbeiten können als die alten? Mehr noch, teilt man nämlich die 13 Mio. auszulagernden Frequenzen auf die existierenden 3270 Kassenfachärzte auf, stellt man verblüfft fest, dass es völlig ausreichen würde, die Kapazitäten der existierenden Fachärzte auszubauen. Ja, das geht so weit, dass, wenn die heutigen Kapazitäten auf die von der Ärztekammer vorgeschlagenen 13.000 eCard-Konsultationen pro Facharzt und Jahr ausgeweitet würden, ALLE Patienten der Spitalsambulanzen von den bestehenden Kassenärzten aufgefangen werden könnten – ganz ohne neue Stellen. Warum also braucht es 1.041 Stellen mehr?
Die Wahrheit?
Am Ende scheint die ganze Modellrechnung eine retrograd kalibrierte Michmädchenrechnung zu sein. Rauskommen musste etwa 300 Mio.€ Einsparung durch mindestens 1.000 neue Kassenstellen mit mindestens 600 Mio.€ mehr Honorare für Kassenärzte (wohl um über entsprechende Einnahmen die Wohlfahrtsfonds zu retten!). Ja, ich denke so irgendwie waren die Vorgaben seitens der Kammerfunktionäre. Und ein williger, vermutlich gut bezahlter Berater hat eine entsprechende Rechnung gemacht, die dann als Ambulanzmodell der Ärztekammer präsentiert wurde.
Nimmt man die Eckdaten dieser Modellrechnung und modeliiert sie ein bisschen realistischer, dann sieht man auch schnell auf welch tönernen Füße sie steht.
Nimmt man beispielsweise rein arbiträr an, dass ein Drittel der verlagerten Frequenzen außerhalb der Ordinationszeiten oder an Wochenenden und nächtens versorgt werden müssen und rechnet dafür 55€ statt 44€ (ein Aufschlag von 25%) nimmt man weiters realistischerweise an, dass die Remanenzkosten für die ausgelagerten Frequenzen bei 60% liegen (das entspricht einem Personalabbau von 33% und einer Sachkostenreduktion von 50%), dann rutsch das ganze von den 322 Mio.€ PLUS auf 139 Mio.€ MINUS.
Niemand soll das falsch verstehen. Eine Verlagerung von der wohnortfernen und unpersönlichen Spitalsambulanz zu wohnortnahen und persönlichen Strukturen ist wichtig, und gesundheitsökonomisch belegbar auch effizienter. Das zeigen echte Rechnungen anderer Länder, die aber deutlich komplizierter sind und stets über konkrete Patientenpfade laufen. Solche Rechnungen freilich würden bei uns bedeuten, in das Machtgefüge einzugreifen – was wohl niemand will! Denn obwohl seit mindestens 15 Jahren der politische Wunsch formuliert ist, Datengrundlagen herzustellen, die es ermöglichen, gesundheitsökonomische Vergleiche zwischen Kassenärzten und Spitalsambulanzen zu ziehen, um eben eine schlüssige Antwort zu finden, wie welche Leistung für welchen Patienten sinnvoll wohnortnäher erbracht werden kann, ist nichts geschehen – und alle tapsen im Dunkel herum.
Milch-Mädchen-Rechnungen wie diese sind eben Garant, der jeweils anderen Seite (Kassen und Politiker machen das genau so!) vorzurechnen, wie verschwenderisch sie ist. Und so kann diesmal die Ärztekammer „beweisen“ wie verschwenderisch Spitäler und wie effizient Kassenärzte arbeiten. Sie kann „simulieren“, dass 1.000 Kassenfachärzte mit etwa 2.000 angestellten Mitarbeitern (davon 1.000 Sprechstundenhilfen!), die Arbeit von etwa 8.000 Spitalsmitarbeitern (davon nur etwa 800 Verwaltungspersonal), abarbeiten können. Und wir können nichts anders tun, als es zu glauben.