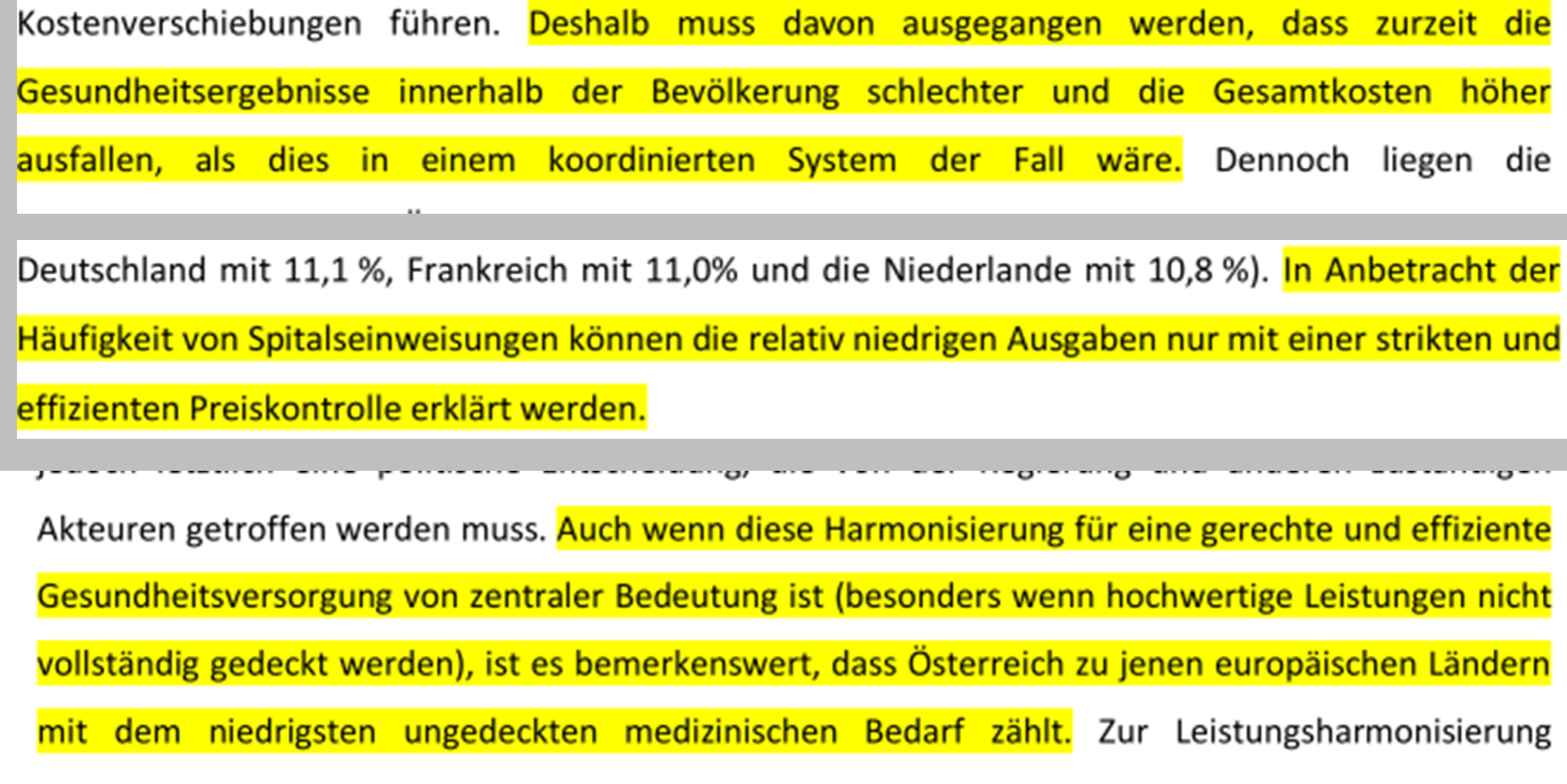Ärztemangel: Weg mit dem Aufnahmetest und her mit mehr, viel mehr Studienplätzen.
Weiterlesen: Mehr Medizin-Universitäten braucht das LandDer Ärztemangel, er hat uns fest im Griff. Kein Tag, an dem nicht über eine nicht nachbesetzbare Kassen-Arztstelle berichtet und auch gleich die Lösung gefunden wird: Wir brauchen mehr Medizin-Absolventen. Die Diskussion schwappt aus Deutschland, wo es wirklich Probleme gibt, nach Österreich. Doch bei uns? Sachlich betrachtet haben wir mit mehr als 505 ärztlich tätigen Medizinern pro 100.000 Einwohner die meisten in der EU – verglichen mit Deutschland (411) gleich um ein Viertel mehr. Da hilft es auch nicht, wenn von manchen politischen Akteuren merkwürdige Rechnungen angestellt werden, um die Zahl kleinerzurechnen; etwa dadurch, dass man Turnusärzte nicht mitzählt, weil die ja noch in der postpromotionellen Ausbildung stehen – was aber falsch ist, weil alle anderen diese mitzählen.
Zudem haben wir keine übermäßige Pensionierungswelle zu erwarten. Der Anteil der Ärzte über 55 Jahren liegt bei etwa 27 Prozent, in Deutschland bei 42. Dort wird es bald wirklich rund gehen.
Vor allem deshalb, weil in Deutschland mit 15 Absolventen pro 100.000 Einwohner nur knapp überdurchschnittlich (EU: 12) viele Mediziner ausgebildet werden. Wir bilden hingegen alleine an öffentlichen Universitäten 23 pro 100.000 Einwohner aus. Zählen wir die privaten Unis dazu, steigt die Zahl auf 27. Da hilft es auch nicht, wenn von manchen politischen Akteuren merkwürdige Rechnungen angestellt werden, um die Zahl kleinerzurechnen, indem etwa nur inländische Absolventen der öffentlichen Unis berücksichtigt werden. So rechnet international niemand – wieso auch?
Also wieso sind sich trotzdem alle so sicher, dass wir einen Ärztemangel haben, der durch mehr Studienplätze (manche verlangen eine Verdoppelung) behebbar ist?
Bei den Ärztekammern kann man das noch irgendwie nachvollziehen. Sie sind die Verwalter eines verpflichtenden Zusatzpensionsprogramms für Ärzte, des sogenannten Wohlfahrtsfonds. Sie können, einem Pyramidenspiel nicht ganz unähnlich, ihren Verpflichtungen aus der Vergangenheit nur nachkommen, wenn die Zahl der Ärzte kontinuierlich wächst – was ja dank der enormen Zahl an Absolventen seit vielen Jahren garantiert ist (im Durchschnitt 900 Ärzte pro Jahr).
Doch warum schreien so viele Politiker? Da, so ist zu vermuten, liegt der Grund wo anders. Es gibt etwa 46.000 Maturanten. Fast jeder Vierte meldet sich beim Aufnahmetest für Medizin an. Doch nur 1100 erhalten einen Studienplatz. Viele Tausende, die nicht durchkommen, haben dann unzufriedene Eltern, von denen sich viele Tausende bei der Politik beschweren – begonnen bei Bürgermeistern, hinauf zu den Landeshauptleuten. Wie kann es sein, dass es Ärztemangel gibt (kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, außerdem müsse man lange auf einen Arzttermin warten, wie es heißt, und Kassenstellen können auch nicht nachbesetzt werden), und das eigene Kind darf nicht studieren? Und der Test sagt gar nichts aus, weil das eigene Kind sicher ein sehr guter Arzt geworden wäre. So etwas ist lästig. Und wie löst man das politisch am elegantesten? Man fordert laut mehr Studienplätze und Abschaffung des Aufnahmetests – wegen des Ärztemangels.
„Wiener Zeitung“ Nr. 194 vom 05.10.2017