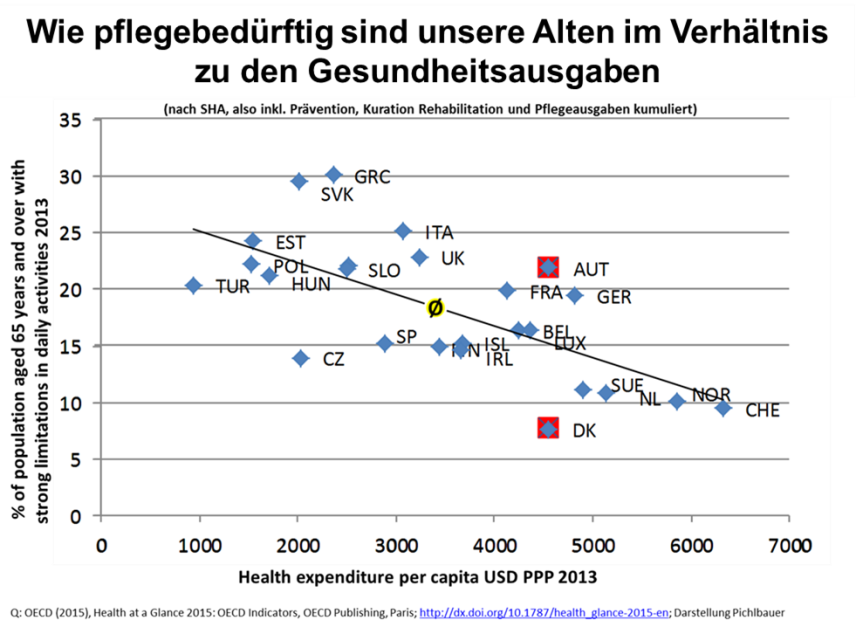Ein Berg hat gekreißt, eine Maus wurde geboren! Die Kassenreform ist nicht für Patienten gemacht, sondern ein parteipolitisches Hickhack.
Weiterlesen: Definitiv nicht die „größte Strukturreform der Zweiten Republik“Dank klientelpolitischer Gesetze ist die ambulante Akutversorgung außerhalb der Spitäler völlig zersplittert. Hier agieren 19 Krankenkassen (KK) und 15 Krankenfürsorgeanstalten (KFA), deren Eigentümer politisch klar zugeordnet werden können, deren Versicherte aber keine Wahl haben. Die Leistungsspektren werden über Leistungs- und Honorarkataloge definiert, die mit anderen Monopolisten verhandelt werden – den zehn Ärztekammern.
Wie viele Kataloge im Umlauf sind, ist nicht klar, denn KFAs entziehen sich jeglicher Kontrolle, am Ende sind es mehr als 20. Wie inhomogen dieses „Preissystem“ ist, zeigt, dass beispielsweise ein EKG im Rahmen eines Hausbesuches bei einem Versicherten der Gebietskrankenkasse (GKK) in Niederösterreich mit 53 Euro honoriert wird, bei einem GKK-Patienten in der Steiermark aber nur mit 13 Euro.
Die gleichen Verhandler bestimmen über Kassen-Stellenpläne auch die Kassenarzt-Dichte – ebenfalls inhomogen. So ist die Kassen-Facharztdichte im Westen Wiens doppelt so hoch wie die im Mühlviertel, obwohl es dort nicht an jeder Ecke Spitalsambulanzen gibt. In der Folge werden Patienten nicht dort behandelt, wo es sinnvoll wäre, sondern dort, wo Angebot und Honorarkataloge sie hinlenken. Um das zu reformieren, muss man tief in die Systemarchitektur eingreifen. Und das hat die Regierung versprochen. Nun wurde die Reform vorgestellt, mit der Kassen fusioniert und Leistungen harmonisiert werden – alleine, die Details sprechen eine andere Sprache. Die KFAs, die traditionell die höchsten Honorare (mindestens doppelt so hoch wie die der GKKs) bezahlen, wurden nicht angerührt. Zwar ist die Zahl der Versicherten verhältnismäßig klein und daher könnte man darüber hinwegsehen, doch, da KFA-Versicherte hauptsächlich in Ballungsräumen leben, stellen sie für Ärzte einen Anreiz dar, dort zu ordinieren. Analoges gilt für SVA und BVA, die ebenfalls ihre Kataloge behalten. Damit wurde die Chance verpasst, für Ärzte Anreize zu setzen, sich außerhalb von Ballungsräumen niederzulassen.
Kernstück der Reform soll aber die Fusion der neun GKKs zu einer ÖGK sein. Versprochen wurde ein einheitlicher Leistungs- und Honorarkatalog. Doch, jedes Bundesland behält eine autonome Landesstelle, die weiter mit den regionalen Ärztekammern eigene Honorarkataloge und Stellenpläne verhandelt und das dafür nötige Budget von der Zentrale kriegen muss. Die Zahl der Kataloge und Stellenpläne ändert sich kaum und damit bleibt alles, wie es ist.
Doch warum dann der Aufruhr? Das liegt an den eingebauten Boshaftigkeiten. Die Zahl der (meist roten Gewerkschafts-) Funktionäre und hohen Verwaltungsposten wird reduziert. Das alleine ist schon ein Angriff auf das austarierte Gefüge der gewerkschaftlichen „Erbpachten“. Richtig böse wird es, wenn man das neu eingeführte Ausbildungsprofil für Funktionäre betrachtet. Entweder müssen sie ein Studium nachweisen oder SV-interne Fort- und Ausbildungen abgeschlossen haben. Wer das nicht hat, darf kein Funktionär mehr sein – das trifft eine ganze Reihe vor allem roter Obmänner und ihre Stellvertreter. Hier wird’s persönlich
„Wiener Zeitung“ Nr. 188 vom 27.09.2018