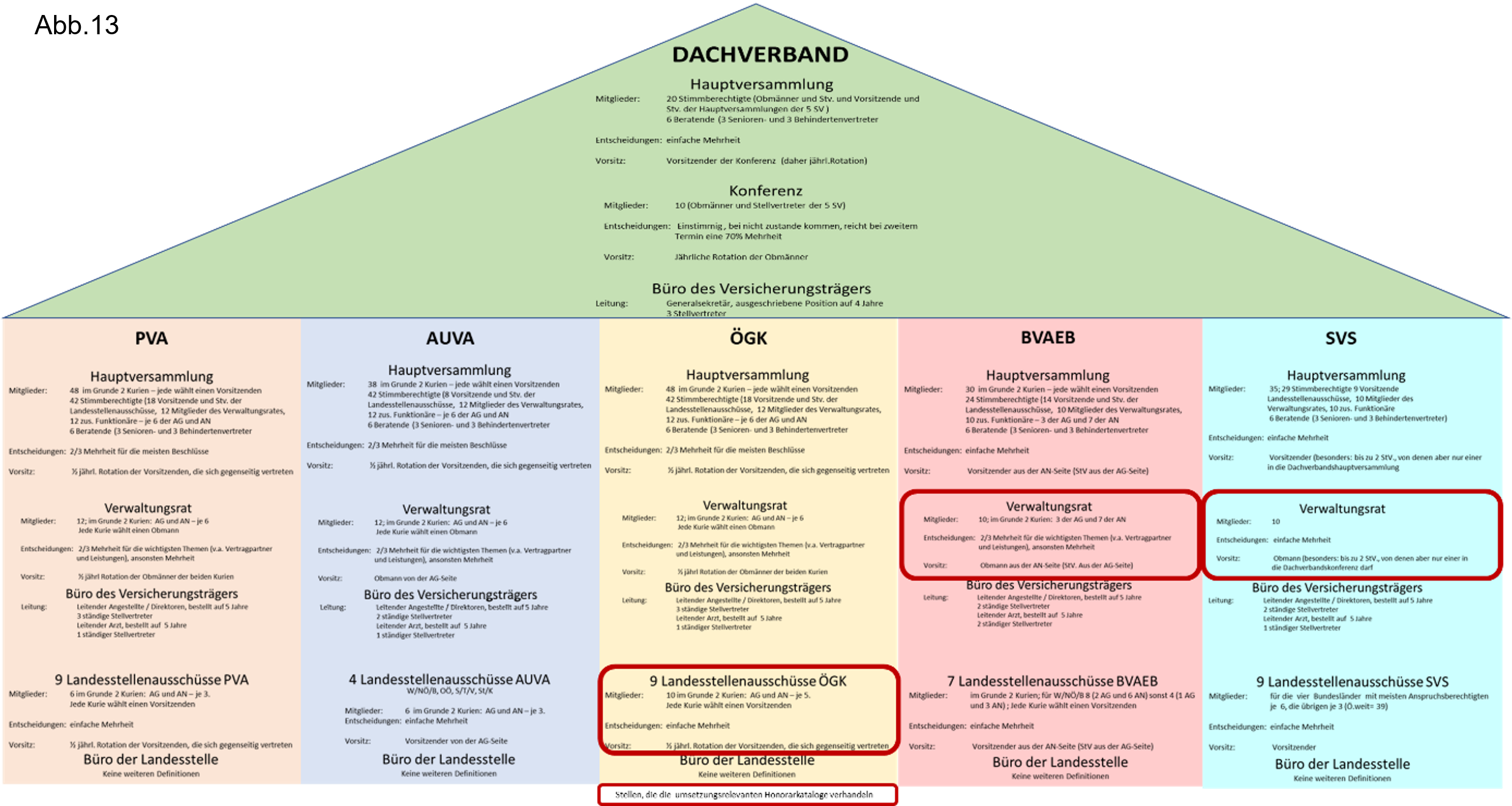Viele Informationen darüber, wie unser Gesundheitssystem funktioniert, sind wegen des Amtsgeheimnisses geheim – aber warum?
Weiterlesen: Jetzt gibt es ein echtes Transparenz-FensterMit welchem Personalschlüssel planen die Niederösterreichischen Spitäler, mit welchem die Wiener? Wie viele Patienten behandeln die Ärzte im Bezirk Kufstein und wie viele überweisen sie an Spitalsambulanzen? Wie viele Mühlviertler oder Favoritner wurden vergangenes Jahr wegen Herzschwäche, COPD oder Diabetes im Spital aufgenommen und wie lange waren Sie dort? Das sind typische Maßzahlen für die Qualität eines Gesundheitssystems. Solche Informationen würden in anderen Ländern regelmäßig und zeitnah veröffentlicht; bei uns ist das anders.
Es ist ja nicht so, dass es diese Informationen nicht gäbe, sie werden halt nur geheim gehalten. Österreichs Gesundheitssystem ist intransparent – im internationalen Vergleich liegt nur mehr ein europäisches Land hinter uns: Griechenland!
Der Grund dafür ist simpel: Nur in der Intransparenz ist es möglich, Mythen wie den des besten Systems der Welt aufrecht zu halten. Und wer schlägt daraus Profit? All jene Politiker, in Kammern, Gewerkschaften und Ländern, die sich eine persönliche Machtposition geschaffen haben, die es zu verteidigen gilt.
Doch wie verteidigen sie die?
Da kommt etwas ins Spiel, das beschönigend Realverfassung genannt wird. Denn die meisten dieser Machtpositionen sind rechtlich gar nicht so stark abgesichert. Aber was noch viel wichtiger ist, die von den Mächtigen hergestellte Intransparenz ist es noch viel weniger.
Das Gesundheitsministerium ist Herr über endlos viele Informationen, die, geschützt durch das Amtsgeheimnis, verborgen bleiben. Zwischen ihnen und der Öffentlichkeit steht oft nur die Realverfassung. Ein Minister, will er nicht in der Versenkung verschwinden, ist zu vorauseilendem Gehorsam verdammt. Nichts, was Kämmerer, Gewerkschafter oder Landesfürsten brüskieren könnte, darf veröffentlicht werden. Sollte ein Minister diesen Gehorsam verweigern, er wäre seinen Job und seine Parteikarriere los.
Und genau da kommt die Übergangsregierung ins Spiel. Welche Karriere steht denn der jetzigen Gesundheitsministerin noch bevor? Welcher Partei muss sie gehorchen? Ein bisschen Mut der Ministerin und ihrer Beamten vorausgesetzt, ein bisschen Schutz durch die Bundeskanzlerin, und vieles könnte die Öffentlichkeit erreichen. Und das ohne rechtliche Gegenwehr, denn, da all diese Informationen ja vorliegen und die Veröffentlichung nur ein Knopfdruck ist, der praktisch nichts kostet, greift nicht einmal der Konsultationsmechanismus, über den die Länder den Bund stets gängeln.
Was rauskäme, wäre nichts Furchtbares, sondern einfach Informationen über den echten Zustand unseres Systems. Damit würde es dem einen oder anderen Mythos, der Ländern, Kammern und Gewerkschaften als Schutz gegen jegliche Reform dient, an den Kragen gehen. Der Boden für eine echte Reform nach den Wahlen wäre aufbereitet. Und was soll schon passieren? Dass einem Minister, weil er gesetzestreu jene Informationen und Daten publiziert, die nur wegen des unerträglichen Gemauschels und Getauschels geheim gehalten werden, das Misstrauen ausgesprochen wird? Von wem?
„Wiener Zeitung“ vom 07.06.2019