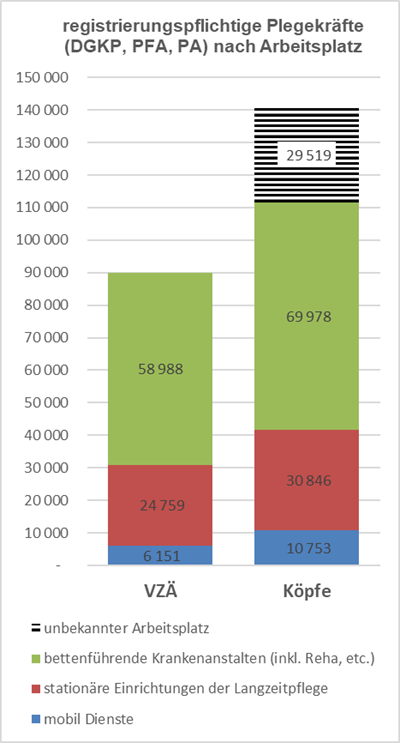Die Österreichische Gesundheitskasse ist seit Anfang 2020 im Amt, der parteipolitische Kampf voll entbrannt.
Weiterlesen: Das Spiel mit den Milliarden der ÖGKWie für unser Gesundheitssystem typisch, streiten sich alle nur ums Geld – und hier vor allem um die berühmte Patientenmilliarde. Die war nie klar, schon gar nicht als Umwandlung aus einer Funktionärsmilliarde – es war ein politischer PR-Gag der schwarz-blauen Regierung, den die Politiker nicht mehr los werden. Populismus hat unter Umständen eben auch kurze Beine. Doch was ist jetzt mit den horrenden Defiziten, die angeblich statt dieser Patientenmilliarde eintreten sollen und Beweis dafür sein sollen, dass die Kassenfusion ein Desaster ist? Die sind genauso ein PR-Gag, jetzt halt von der anderen Seite, also der roten, vor allem von der Gewerkschaft.
Wer sich mit der Gebarungsvorschaurechnung der Krankenkassen (allein das Wort zeigt, aus welcher Epoche das kommt) beschäftigt hat, erkennt, wie „taktisch“ die Rechnungen waren. Sie haben stets einem Verhandlungsziel gegolten, um entweder die Einnahmen (Steuersubventionen) zu erhöhen oder die Ausgaben (Honorare und Medikamentenpreise) zu senken, nie jedoch, um Transparenz herzustellen. Während zwischen 2009 und 2018 von den Kassen kumuliert ein Verlust von 2547 Millionen Euro „vorausgerechnet“ wurde, kam bei der Abrechnung ein kumuliertes Plus von 1674 Millionen Euro heraus – eine Differenz von 4221 Millionen. Besonders krass war das Jahr 2012, da wurde aus einem vorausgerechneten Minus von 737 Millionen in Jahresfrist ein Plus von 181 Millionen!
Und warum sind all diese Zahlen so herrlich manipulativ einsetzbar? Nun, dass liegt an der Verwendung der absoluten Zahlen; die klingen sehr schnell sehr hoch, auch wenn es nur um wenige Prozent geht. Aktuell macht die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) einen jährlichen Umsatz von etwa 16.000 Millionen Euro – ein einzelnes Prozent sind also schon 160 Millionen.
Und wenn man dann noch über ein paar Jahre kumuliert, werden die Zahlen noch höher. Und die skandalösen 1700 Millionen Euro Defizit, die die ÖGK bis 2024 angeblich machen wird, klingen halt viel besser, als wenn man von zwei Prozent sprechen würde. Und wer bedenkt, wie sich die Kassen schon bei einer Jahresprognose verrechnen, weiß, dass Fünf-Jahres-Prognosen schlicht Kaffeesudlesen sind, und ein Defizit von zwei Prozent eine statistische Unschärfe sein muss.
Doch um das ging es ja nicht– es ging darum, der einen populistischen Milliarde eine andere gegenüberzusetzen, um die eigene Klientel glücklich zu stimmen und zu mobilisieren.
Politisch betrachtet jedoch, war es wohl eine „rote“ Dummheit, diese „Defizite“ so hoch zu rechnen und medial auszuschlachten, dass nun jeder weiß, die ÖGK steht vor einem Milliardendefizit. Denn auch wenn es nichts mit der Realität zu tun hat, wird es der jetzigen Regierung ein Leichtes sein, die Patientenmilliarde, wenn auch nicht wie versprochen bis 2023, so aber doch bis 2024 darzustellen. Denn bereits jetzt kann vorausgesagt werden, dass das Minus der Kassen völlig ohne Leistungskürzungen bis 2024 unter 700 Millionen Euro liegen wird – damit konnte „eine Milliarde im System gespart“ werden! Und es wird niemanden geben, der diesen Mythos brechen kann
„Wiener Zeitung“ vom 27.02.2020